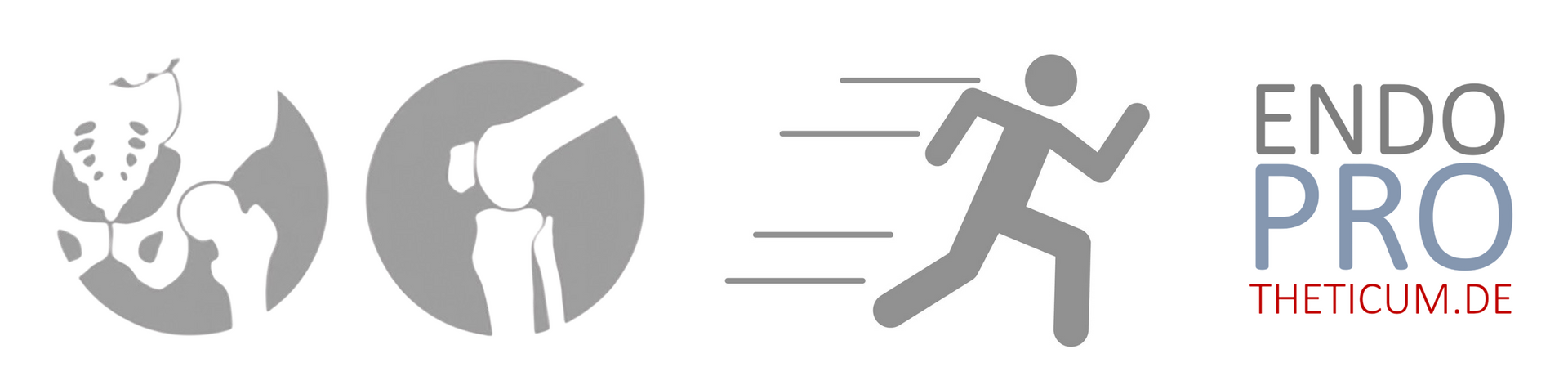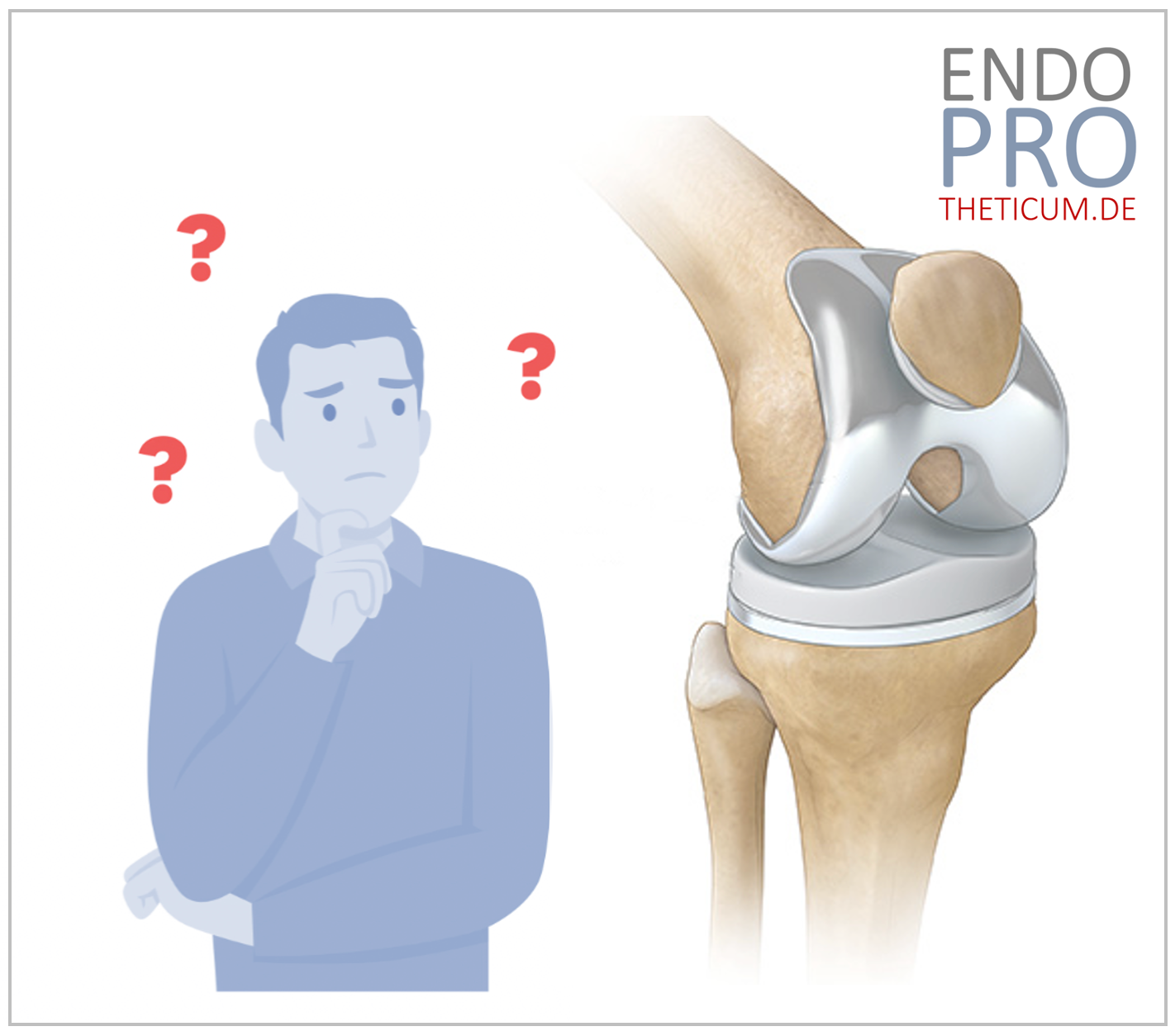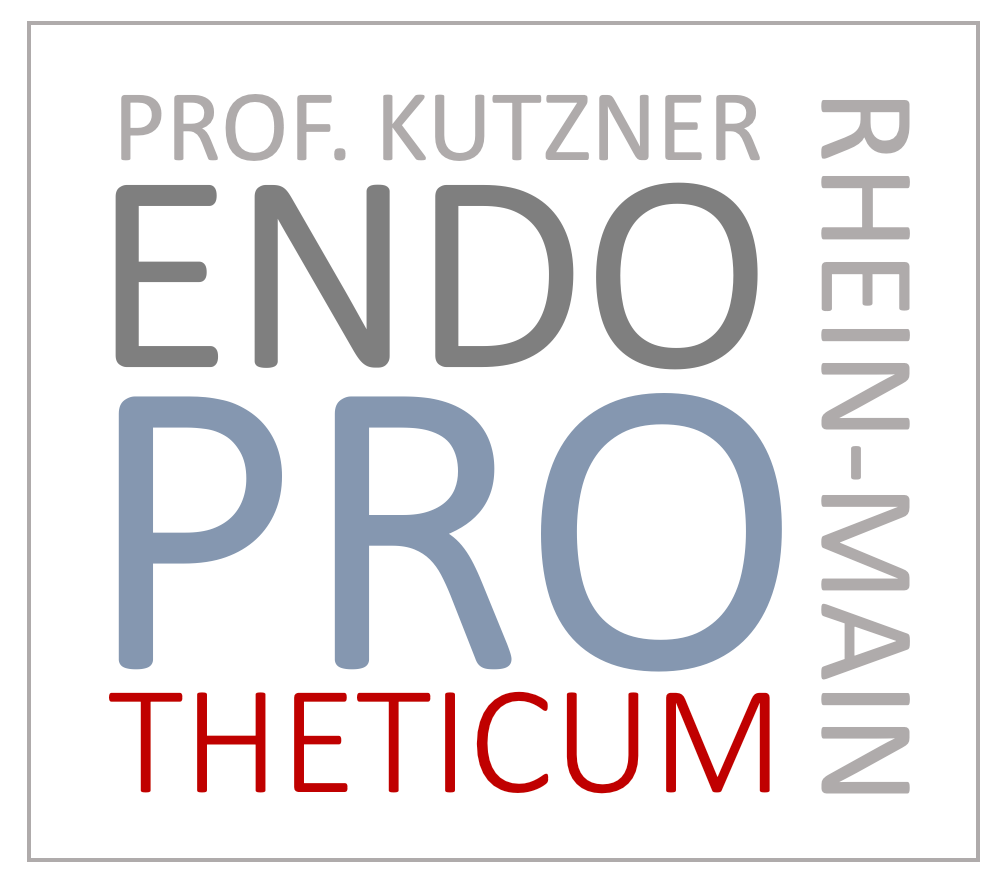Prothesenlockerung: Wie lässt sie sich feststellen?
Die Lockerung von Hüftprothesen (Hüft-TEP) und Knieprothesen (Knie-TEP) stellt eine große Herausforderung dar!

Die Implantation eines künstlichen Gelenks stellt für viele Menschen eine enorme Verbesserung der Lebensqualität dar. Hüft- und Knieendoprothesen ermöglichen es Patienten, nach Jahren der Schmerzen wieder mobil und aktiv zu sein. Doch trotz aller Fortschritte in der Endoprothetik bleibt eine gefürchtete Komplikation bestehen: die Prothesenlockerung. Besonders kritisch ist sie bei einer Hüft-TEP und Knie-TEP, da unbehandelte Lockerungen nicht nur Schmerzen verursachen, sondern auch das Risiko schwerer Folgeerkrankungen erhöhen. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Ursachen, Symptome, Diagnoseverfahren und Behandlungsoptionen bei einer Prothesenlockerung.
Was ist eine Prothesenlockerung?
Eine Prothesenlockerung liegt vor, wenn die künstliche Gelenkkomponente ihre feste Verankerung im Knochen verliert. Diese Lockerung kann mechanischer oder infektiöser Natur sein. Im Gegensatz zu den normalen altersbedingten Veränderungen eines Implantats führt eine echte Lockerung immer zu einer Einschränkung der Funktion und meist auch zu Schmerzen.
Es gibt zwei Hauptformen:
- Aseptische Prothesenlockerung: Ohne bakterielle Beteiligung, meist mechanisch bedingt.
- Septische Prothesenlockerung: Durch bakterielle Infektionen verursacht.
Beide Formen erfordern unterschiedliche diagnostische und therapeutische Vorgehensweisen.
Ursachen einer Prothesenlockerung
Aseptische Ursachen einer Lockerung
Die aseptische Lockerung ist die häufigste Form. Hierbei spielen folgende Faktoren eine Rolle:
- Abriebpartikel: Abnutzung von Polyethylen oder Metall setzt kleinste Partikel frei, die eine Entzündungsreaktion im Knochen auslösen können. Dies führt zu einer Osteolyse (Knochenabbau).
- Fehlbelastungen: Achsabweichungen, Beinlängendifferenzen oder muskuläre Dysbalancen führen zu einer ungleichmäßigen Belastung des Implantats.
- Materialermüdung: Langfristige mechanische Beanspruchung kann die Implantate schwächen.
- Minderwertige Knochenqualität: Osteoporose oder Knochennekrosen beeinträchtigen die Implantatverankerung.
Septische Ursachen einer Lockerung
Eine septische Lockerung ist eine schwerwiegende Komplikation:
- Periprothetische Infektionen: Bakterien (z. B. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis) siedeln sich auf der Prothesenoberfläche an und bilden einen Biofilm, der schwer zu behandeln ist.
- Hämatogene Streuung: Infektionen wie Zahnwurzelentzündungen oder Harnwegsinfekte können Keime über die Blutbahn zum Gelenk transportieren.
Symptome einer Prothesenlockerung
Nicht immer ist eine Prothesenlockerung sofort offensichtlich. Typische Symptome sind:
- Belastungsschmerzen, oft auch Ruheschmerzen
- Instabilitätsgefühl im betroffenen Gelenk
- Schwellung und Überwärmung
- Eingeschränkte Beweglichkeit
- Klickende oder schabende Geräusche beim Bewegen
- Fieber (bei septischer Lockerung)
- Kraftverlust im Bein
Das Beschwerdebild kann schleichend beginnen und wird im Verlauf stärker.
Diagnostik: Wie wird eine Prothesenlockerung festgestellt?
Die Diagnostik einer Prothesenlockerung erfordert eine Kombination aus klinischer Untersuchung und bildgebenden sowie laborchemischen Verfahren:
1. Klinische Untersuchung
- Beurteilung von Gangbild, Beinlänge, Beweglichkeit, Schmerzen, Ergüssen
2. Bildgebende Verfahren
- Röntgen: Standardmethode zur Beurteilung von Lockerungszeichen wie Spaltbildungen oder Migrationen
- CT: Detaillierte Darstellung von Knochenstrukturen und Implantatposition
- Skelettszintigrafie oder PET-CT: Früherkennung von Lockerungen durch gesteigerte Aktivität im Knochenstoffwechsel
3. Laboruntersuchungen
- Entzündungsmarker: CRP, Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG)
- Blutkulturen bei septischem Verdacht
4. Gelenkpunktion
- Analyse von Gelenkflüssigkeit zur Keimbestimmung
Warum die Skelettszintigraphie eine Lockerung erst nach 1,5 Jahren zuverlässig nachweisen kann
Die Skelettszintigraphie gilt als sensitiv, aber wenig spezifisch in der Diagnostik von Prothesenlockerungen. In den ersten 12 bis 18 Monaten nach der Operation zeigt sich in der Szintigrafie häufig eine normale postoperativ erhöhte Stoffwechselaktivität im Bereich der Prothese. Diese stellt jedoch keinen Beweis für eine Lockerung dar. Erst wenn diese Aktivität über die erwartete Zeit hinaus bestehen bleibt oder sich neu entwickelt, kann eine pathologische Veränderung angenommen werden. Deshalb ist die Szintigraphie erst frühestens 1,5 Jahre postoperativ sinnvoll interpretierbar, da vorherige Ergebnisse zu häufig falsch-positiv sind.
Hier mehr Infos: skelettszintgraphie-bei-der-diagnostik-der-prothesenlockerung
Therapieoptionen bei Prothesenlockerung
Je nach Ursache unterscheidet sich das Vorgehen erheblich:
- Aseptische Lockerung: Wechseloperation der gelockerten Komponenten oder der gesamten Prothese.
- Septische Lockerung:
- Zweizeitiges Vorgehen: Entfernung der Prothese, antibiotische Therapie und spätere Neuimplantation.
- Seltener einzeitig: Nur bei hochspezialisierten Zentren und unter bestimmten Bedingungen.
Die Wahl der neuen Prothese hängt von der Knochensituation ab. Häufig werden sogenannte Revisionsimplantate eingesetzt.
Hüftgelenk – Lockerung einer Hüftprothese (Hüft-TEP)
Ursachen der Lockerung einer Hüft-TEP
Bei der Lockerung einer Hüft-TEP spielen folgende Faktoren eine Rolle:
- Abrieb von Polyethyleninlays
- Achsfehlstellungen nach Primärimplantation
- Alterungsprozesse des Implantats
- Primäre Infektionen oder Spätinfektionen
Symptome bei gelockerter Hüftprothese
Häufig klagen Patienten über:
- Leistenschmerzen
- Stechende Schmerzen im Oberschenkel
- Belastungsschmerzen beim Treppensteigen oder Aufstehen
- Gangunsicherheit
- Verkürztes Bein oder veränderte Beinachse
Diagnostik bei Lockerung Hüft-TEP
- Röntgenaufnahmen (Beckenübersicht, axialer Strahlengang)
- Knochenszintigrafie
- Laborkontrollen
- CT bei komplexen Fällen
- Punktion bei Infektionsverdacht
Therapie bei Lockerung Hüft-TEP
- Austausch der gelockerten Komponenten (nur Pfanne oder nur Schaft)
- Wechsel auf modulare Schaftsysteme oder Revisionspfannen
- Knochenaufbau mittels Spongiosaplastik bei Defekten
- Antibiotische Therapie bei septischer Ursache
Besondere Herausforderungen
- Wiederherstellung der Beinlänge
- Rekonstruktion der Rotationszentren
- Vermeidung weiterer Lockerungen
Kniegelenk – Lockerung einer Knieprothese (Knie-TEP)
Ursachen der Lockerung einer Knie-TEP
Die Lockerung einer Knie-TEP kann resultieren aus:
- Polyethylenverschleiß und Abrieb
- Lockerung des Tibiaschaftes
- Achsfehlstellungen (z. B. Valgus- oder Varusgonarthrose)
- Bandinstabilitäten
- Infektionen
Symptome bei gelockerter Knieprothese
Typische Symptome sind:
- Belastungsabhängige Schmerzen
- Instabilitätsgefühle beim Gehen
- Schwellung, besonders nach Belastung
- Ergüsse im Kniegelenk
- Bewegungseinschränkungen
- Knack- oder Klopfgeräusche
Diagnostik bei Lockerung Knie-TEP
- Röntgenbilder unter Belastung
- Long-leg-view zur Beurteilung der Beinachse
- Knochenszintigrafie oder PET-CT
- Laborchemische Tests zur Infektsuche
- Punktion bei Verdacht auf septische Lockerung
Therapie bei Lockerung Knie-TEP
- Austausch des Tibiateils, Femurteils oder beider Anteile
- Verwendung von modularen Revisionsprothesen mit Achsführung
- Knochenaufbau mittels Metall- oder Knochenaugmentaten
- Gezielte Antibiotikatherapie bei Infektion
Prävention: Prothesenlockerungen vorbeugen
- Gewichtsreduktion
- Regelmäßige Zahnarztkontrollen
- Vermeidung von Risikoinfektionen
- Schonende Sportarten (Schwimmen, Radfahren)
- Regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen
Prognose nach Revisionsoperation bei Lockerung
Die Ergebnisse nach Revisionseingriffen sind in spezialisierten Zentren sehr gut:
- 80-90 % der Revisionsprothesen halten mindestens 10 Jahre.
- Die Mobilität kann weitgehend wiederhergestellt werden.
FAQ: Häufige Fragen zur Prothesenlockerung
Wie fühlt sich eine gelockerte Hüft-TEP an?
- Häufig Leistenschmerzen, Instabilitätsgefühl und eingeschränkte Belastbarkeit.
Wie lange hält eine Knie-TEP?
- Moderne Knieprothesen halten im Schnitt 15-20 Jahre, manchmal länger.
Ist jede Lockerung eine Notfalloperation?
- Nein, aber eine deutliche Lockerung sollte rasch behandelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Ausblick: Reha, Nachsorge und Prävention
Eine strukturierte Rehabilitation nach Revisionsoperationen ist entscheidend für die Rückkehr zur Mobilität. Bereits präoperativ sollte mit Aufklärung und Planung begonnen werden. Während der stationären Reha stehen Mobilisation, Physiotherapie und Schmerzmanagement im Vordergrund. Im Anschluss sind ambulante Programme empfehlenswert, die gezielt auf Gangbild, Muskelkraft und Gelenkfunktion eingehen.
Prävention von Prothesenlockerungen beginnt lange vor der ersten Operation:
- Sorgfältige Auswahl des Implantats
- Korrekte Positionierung
- Behandlung von Risikofaktoren (z. B. Osteoporose)
- Regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen
- Patientenschulung zum Verhalten im Alltag (z. B. Sturzprophylaxe, gelenkschonende Belastung)
Wissenschaftliche Studien und Evidenzlage
Zahlreiche Studien belegen die Relevanz und Häufigkeit von Prothesenlockerungen:
- Eine große Registeranalyse des Endoprothesenregisters Deutschland (EPRD) zeigt, dass etwa 5–10 % aller Endoprothesen innerhalb von 10 Jahren aufgrund einer Lockerung revidiert werden müssen.
- Studien zur aseptischen Lockerung beschreiben Abrieb als Hauptursache – insbesondere bei Polyethylen-Inlays älterer Generation.
- Bei septischen Lockerungen wurde in einer Metaanalyse gezeigt, dass das zweizeitige Revisionsverfahren eine höhere Erfolgsrate im Vergleich zum einzeitigen Wechsel aufweist (Erfolgsrate >90 %).
- Moderne bildgebende Verfahren wie die PET/CT mit markierten Leukozyten befinden sich in der Weiterentwicklung und bieten verbesserte Sensitivität bei unklaren Fällen.
Einflussfaktoren laut Studienlage:
- Rauchen, Diabetes mellitus und Adipositas erhöhen das Risiko für eine Lockerung signifikant.
- Männer sind geringfügig häufiger betroffen als Frauen.
- Patienten unter 60 Jahren mit höherem Aktivitätsniveau haben ein erhöhtes Revisionsrisiko.
Fazit: Frühzeitige Diagnose einer Prothesenlockerung schützt Mobilität
Eine früh erkannte Prothesenlockerung kann meist erfolgreich behandelt werden. Wer typische Symptome wie Schmerzen oder Instabilität ernst nimmt und zeitnah medizinische Hilfe sucht, schützt seine Lebensqualität langfristig.
Sie haben Schmerzen an Ihrer Hüft- oder Knieprothese?
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin im ENDOPROTHETICUM, Ihrer Spezialpraxis für Endoprothetik.
➡️ Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihre Mobilität!
TERMIN VEREINBAREN?
Gerne können Sie einen Termin sowohl telefonisch, als auch online vereinbaren.